Abakus – „Rechenmaschine“
 Eine solche bzw. ähnliche Rechenhilfe kann bereits auf eine etwa
3000-jährige Tradition zurückschauen. In ganz unterschiedlichen Kulturen war er
in ähnlicher Weise vorhanden. Die auf Drähten laufenden Kugeln stellen dabei durch
ihre Lage eine bestimmte Zahl dar und es wird normalerweise ein Stellenwertsystem zugrunde gelegt. Ein Abakus ermöglicht die
Durchführung der Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Eine „Rechenmaschine“ wie der
hier abgebildete Abakus wurde von Kindern der ersten Schuljahre noch bis weit ins
20. Jh. verwendet. Heute sind auch die Kinder längst auf elektronische
Rechenhilfen „umgestiegen“.
Eine solche bzw. ähnliche Rechenhilfe kann bereits auf eine etwa
3000-jährige Tradition zurückschauen. In ganz unterschiedlichen Kulturen war er
in ähnlicher Weise vorhanden. Die auf Drähten laufenden Kugeln stellen dabei durch
ihre Lage eine bestimmte Zahl dar und es wird normalerweise ein Stellenwertsystem zugrunde gelegt. Ein Abakus ermöglicht die
Durchführung der Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Eine „Rechenmaschine“ wie der
hier abgebildete Abakus wurde von Kindern der ersten Schuljahre noch bis weit ins
20. Jh. verwendet. Heute sind auch die Kinder längst auf elektronische
Rechenhilfen „umgestiegen“.
(Das Fotomotiv ist neben vielen weiteren Zeugnissen
regionaler Geschichte zu finden im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg).
Foto: Elfriede Böhm
Dorfschule
im 19. Jahrhundert
 Ein
typischer Klassenraum der Dorfschule des 19. und frühen 20.
Jh. mit engen Holzbänken mit eingelassenen Tintenfässchen für die
älteren Schüler; die jüngeren Kinder benutzten die immer wieder
verwendbare Schiefertafel mit Griffel und Wischlappen. Das Katheder
des Lehrers, ein Stehpult, war geeignet für den obligatorischen
"Frontalunterricht" - oft auch für mehr als eine Klasse
im gleichen Raum. In der alten, (Zweiraum-)Schule in Immendorf wurden
z. B. noch bis 1964 vier Klassenstufen in einem Raum gleichzeitig
unterrichtet, was diesen mit um die fünfzig (!) Schülern füllte.
Ein Wunder, dass so überhaupt akzeptable Lernergebnisse zustande
kamen. Unterricht war für Lehrer und Schüler gleichermaßen eine
Herausforderung, die nur mit viel Disziplin gemeistert werden konnte.
Ein
typischer Klassenraum der Dorfschule des 19. und frühen 20.
Jh. mit engen Holzbänken mit eingelassenen Tintenfässchen für die
älteren Schüler; die jüngeren Kinder benutzten die immer wieder
verwendbare Schiefertafel mit Griffel und Wischlappen. Das Katheder
des Lehrers, ein Stehpult, war geeignet für den obligatorischen
"Frontalunterricht" - oft auch für mehr als eine Klasse
im gleichen Raum. In der alten, (Zweiraum-)Schule in Immendorf wurden
z. B. noch bis 1964 vier Klassenstufen in einem Raum gleichzeitig
unterrichtet, was diesen mit um die fünfzig (!) Schülern füllte.
Ein Wunder, dass so überhaupt akzeptable Lernergebnisse zustande
kamen. Unterricht war für Lehrer und Schüler gleichermaßen eine
Herausforderung, die nur mit viel Disziplin gemeistert werden konnte.
(Das Fotomotiv ist neben vielen weiteren Zeugnissen regionaler
Geschichte zu finden im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg).
Foto: Elfriede Böhm
Buch
"Der Haussekretär" (um 1900) - Illustrierte Haus- und
Weltbibliothek von Merkur
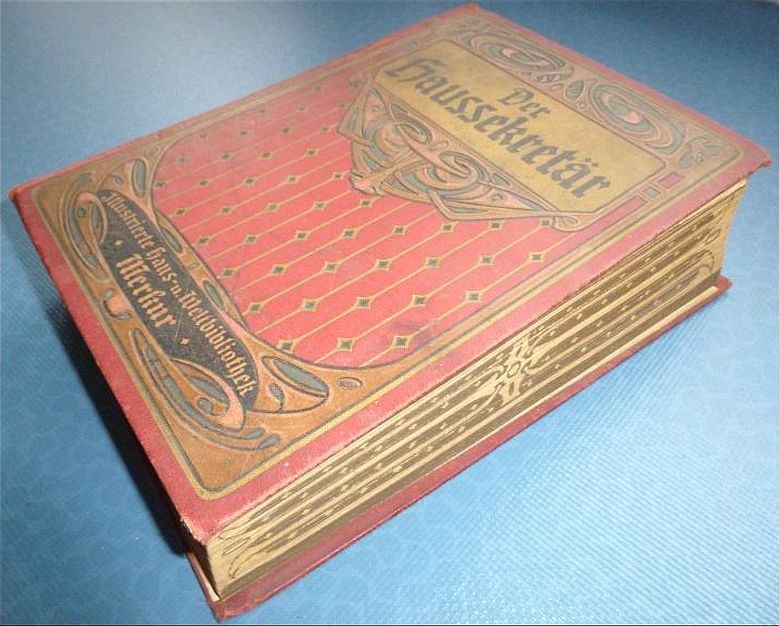 Inhalte
dieses nützlichen Helfers im häuslichen "Büro":
Inhalte
dieses nützlichen Helfers im häuslichen "Büro":
*
Über die Kunst des Briefschreibens
* Offizielle
und private Musterbriefe
* Titulaturen, Anreden,
Adressen vom Kaiser und Kardinälen,
von Offizieren bis zu den
Beamten
* Mathematik
* Formulare aller Art
* Lexikon der
gängigsten Abkürzungen
* Rechtschreibung
*
Fremdwörterbuch
* Schriftsätze im Vereinswesen
*
Goldene Kernsprüche und Lebensregeln
Beachtenswert auch, das wunderschöne, heute kaum noch zu findende Buchschnittornament.
Zur Verfügung gestellt von Konrad Frank
Buch "Haus-Apotheke" mit
Widmung (s.u.) vom Krankenbett am 17.11.1943
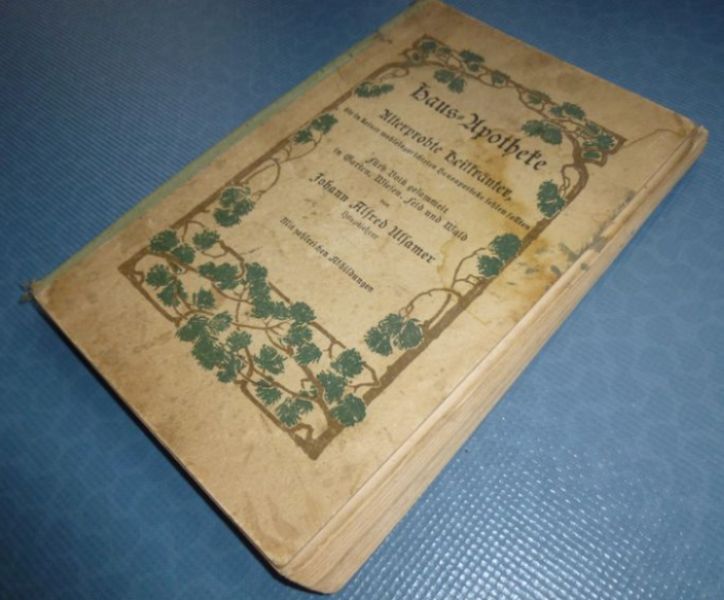 „Alterprobte Heilkräuter, die in keiner wohleingerichteten
Hausapotheke fehlen sollten. Fürs Volk gesammelt in Garten, Wiesen, Feld und
Wald" von Johann Alfred Ulsamer, hier: 13. Auflage, 1926, Verlag Josef Kösel &
Friedrich Pustet, München.
„Alterprobte Heilkräuter, die in keiner wohleingerichteten
Hausapotheke fehlen sollten. Fürs Volk gesammelt in Garten, Wiesen, Feld und
Wald" von Johann Alfred Ulsamer, hier: 13. Auflage, 1926, Verlag Josef Kösel &
Friedrich Pustet, München.
In einer Zeit, in der der Gang zur Apotheke noch
nicht so selbstverständlich war wie heute, wurden viele Leiden mit
Kräutern und anderen "Hausmitteln" behandelt. Das Wissen
um diese Hausmittel wurde lange von Generation zu Generation weiter
gegeben.
Zur Verfügung gestellt von Konrad Frank
Widmung vom Krankenbett am 17.11.1943
im Buch "Die Haus-Apotheke" (s.o.)
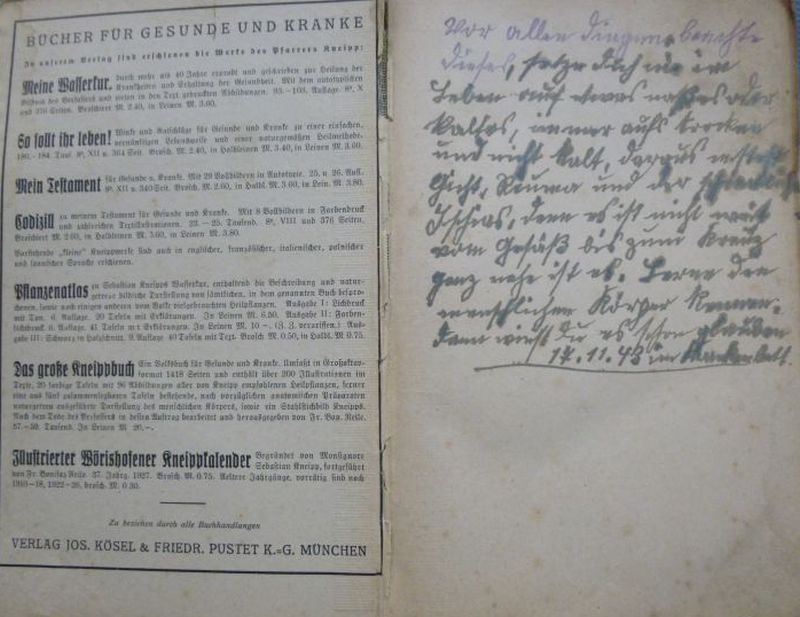 Wer
diese dringliche Widmung schrieb, ist unbekannt, aber man darf davon
ausgehen, dass sie in Verbindung mit großen Schmerzen geschrieben
wurde. Sie lautet: "Vor allen Dingen beachte dieses, setze Dich
nie im Leben auf etwas Nasses oder Kaltes, immer aufs Trockene
und nicht kalt, daraus entstehen Gicht, R(h)euma und der schmerzende Ischias,
denn es ist nicht weit vom Gesäß bis zum Kreuz, ganz nahe ist
es. Lerne den menschlichen Körper kennen. Dann wirst Du es schon
glauben.
Wer
diese dringliche Widmung schrieb, ist unbekannt, aber man darf davon
ausgehen, dass sie in Verbindung mit großen Schmerzen geschrieben
wurde. Sie lautet: "Vor allen Dingen beachte dieses, setze Dich
nie im Leben auf etwas Nasses oder Kaltes, immer aufs Trockene
und nicht kalt, daraus entstehen Gicht, R(h)euma und der schmerzende Ischias,
denn es ist nicht weit vom Gesäß bis zum Kreuz, ganz nahe ist
es. Lerne den menschlichen Körper kennen. Dann wirst Du es schon
glauben.
17.11.43 vom Krankenbett."
Zur Verfügung gestellt von Konrad Frank
Mein erstes
Geschichtsbuch (1925)
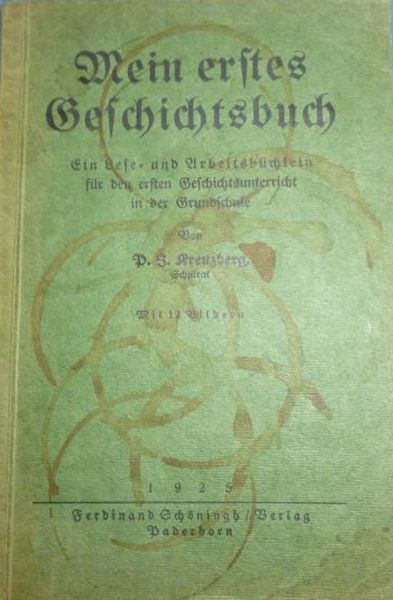
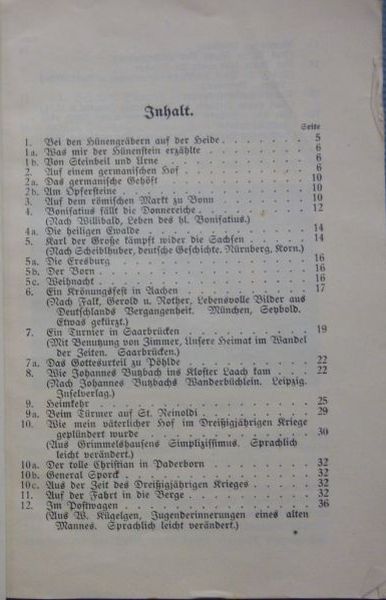 Ein Lese und Arbeitsbüchlein für den ersten
Geschichtsunterricht in der Grundschule
Ein Lese und Arbeitsbüchlein für den ersten
Geschichtsunterricht in der Grundschule
(Deckel und Inhaltsverzeichnis /
44 Seiten / 12 Bilder
/ Ferd. Schöningh-Verlag, Paderborn)
Wichtige geschichtliche Ereignisse, aber auch Sagen und Legenden wurden in diesem kleinen Büchlein kindgerecht in kurzen bebilderten Geschichten erzählt.
Zur Verfügung gestellt von Konrad Frank, Idf.
Buch:
Perlen aus dem Sagenschatze des Rheinlandes
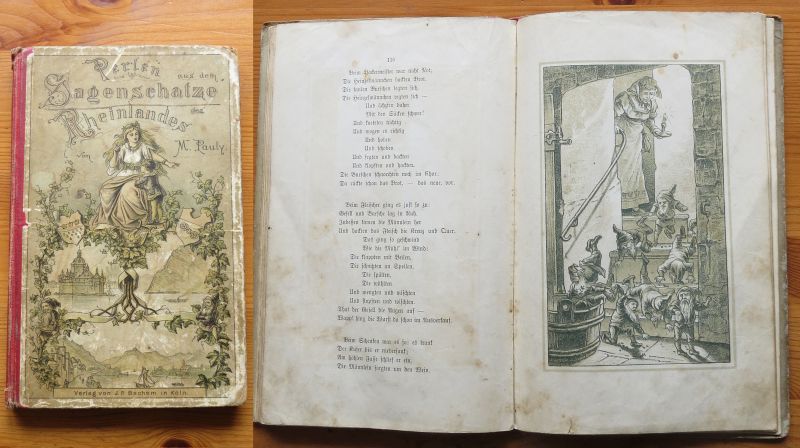 Sagen,
Mythen, Märchen und ähnliche Geschichten hatten im 19. Jahrhundert
Hochkonjunktur, entsprachen sie doch durchaus dem Geist der Romantik,
die in der Literatur ebenso wie in der bildenden Kunst in
Mode kam. Man besann sich auf alte Zeiten und schwelgte geradezu
im Mythologischen.
Sagen,
Mythen, Märchen und ähnliche Geschichten hatten im 19. Jahrhundert
Hochkonjunktur, entsprachen sie doch durchaus dem Geist der Romantik,
die in der Literatur ebenso wie in der bildenden Kunst in
Mode kam. Man besann sich auf alte Zeiten und schwelgte geradezu
im Mythologischen.
Zur Verfügung gestellt von Margret Biemer, Arenberg.
Buch:
Deutsche Sagen (1804)
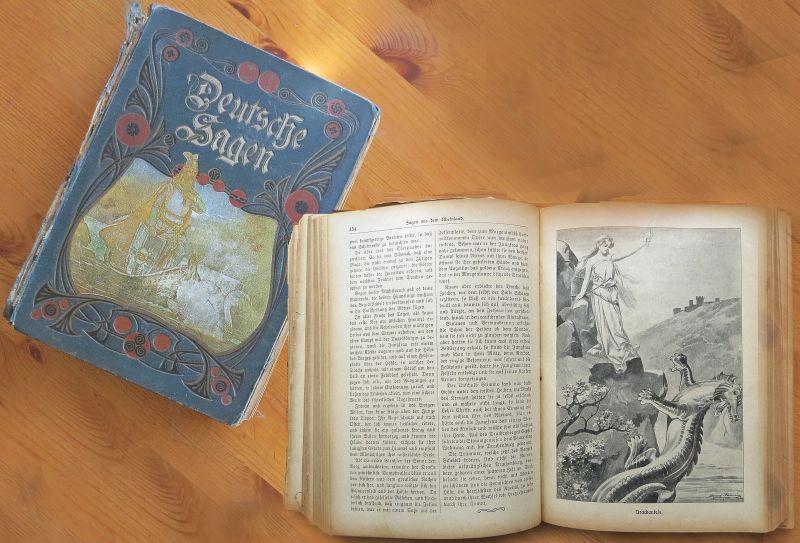 Bereits
ganz früh im 19. Jh. präsentiert ein Buch in schönstem Jugendstil-
Design Deutsche Sagen. Bekannt wurden zu dieser Zeit Sammler wie
die Gebrüder Grimm, aber auch Dichter und Literaten wie Wilhelm
Hauff, Clemens Brentano, Achim von Arnim, Heinrich Heine u. a. Zur
Pflege der traditionellen Sagen gehörte auch die Pflege des
Volkslieds. Das Lied von der Lore-Ley stammt z. B. aus dieser Zeit
und ist eine der bekanntesten romantischen Dichtungen von Heine,
vertont von Friedrich Silcher.
Bereits
ganz früh im 19. Jh. präsentiert ein Buch in schönstem Jugendstil-
Design Deutsche Sagen. Bekannt wurden zu dieser Zeit Sammler wie
die Gebrüder Grimm, aber auch Dichter und Literaten wie Wilhelm
Hauff, Clemens Brentano, Achim von Arnim, Heinrich Heine u. a. Zur
Pflege der traditionellen Sagen gehörte auch die Pflege des
Volkslieds. Das Lied von der Lore-Ley stammt z. B. aus dieser Zeit
und ist eine der bekanntesten romantischen Dichtungen von Heine,
vertont von Friedrich Silcher.
Zur Verfügung gestellt von Margret Biemer,
Arenberg.
Liederbuch von 1864
"Lieder in Volkes Herz und Mund"
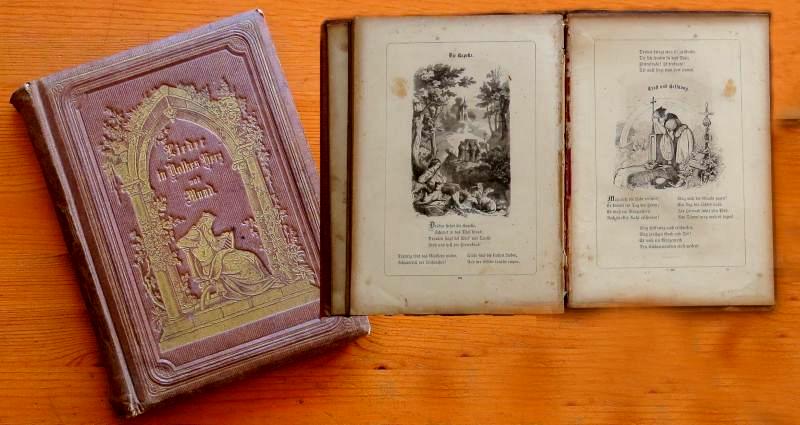 Volkslieder- und Balladen- Bücher gehörten im 19. Jh.
in jeden Haushalt und natürlich auch in den Unterricht aller Schulen. Es war
die Zeit der Romantik, die Dichter und Komponisten dazu animierte, neben den in
alter Tradition überlieferten Liedern neue zu dichten und zu komponieren. Namen
wie Heinrich Heine, Clemens Brentano, Ludwig Uhland und Friedrich Silcher
stehen hier nur beispielhaft für viele in dieser Hochphase des Liedgutes, das
bis weit ins 20. Jh. hinein Konjunktur hatte und auch heute noch in vielen
Chören gepflegt wird. Liederbücher waren darüber hinaus oft mit romantischen
Zeichnungen oder Stichen geschmückt, die - ebenso wie die Lieder - die
Sehnsucht nach einer heilen Welt widerspiegelten, die es natürlich weder in der
Zeit der aufkeimenden Industrialisierung noch davor oder danach in dem
ersehnten Maß gab. Aber die Sehnsucht danach wurde selten so intensiviert wie
in der Zeit Romantik.
Volkslieder- und Balladen- Bücher gehörten im 19. Jh.
in jeden Haushalt und natürlich auch in den Unterricht aller Schulen. Es war
die Zeit der Romantik, die Dichter und Komponisten dazu animierte, neben den in
alter Tradition überlieferten Liedern neue zu dichten und zu komponieren. Namen
wie Heinrich Heine, Clemens Brentano, Ludwig Uhland und Friedrich Silcher
stehen hier nur beispielhaft für viele in dieser Hochphase des Liedgutes, das
bis weit ins 20. Jh. hinein Konjunktur hatte und auch heute noch in vielen
Chören gepflegt wird. Liederbücher waren darüber hinaus oft mit romantischen
Zeichnungen oder Stichen geschmückt, die - ebenso wie die Lieder - die
Sehnsucht nach einer heilen Welt widerspiegelten, die es natürlich weder in der
Zeit der aufkeimenden Industrialisierung noch davor oder danach in dem
ersehnten Maß gab. Aber die Sehnsucht danach wurde selten so intensiviert wie
in der Zeit Romantik.
Zur Verfügung gestellt von Margret Biemer, Arenberg.
Teil eines
lateinischen Wörterbuchs von 1858 (Buchstaben G-P)
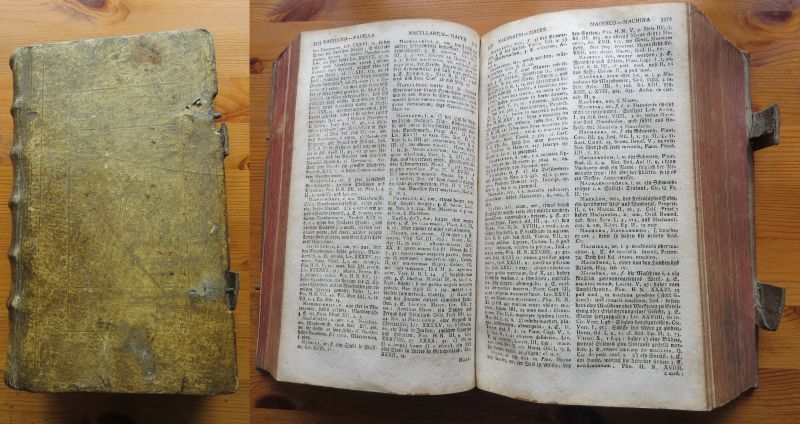 Iro-schottische Mönche, die auf ihren Missionsreisen das
Christentum in Europa verbreiteten, waren wohl die ersten, die in Klosterschulen
Latein lehrten. Latein galt über das gesamte Mittelalter bis
in die frühe Neuzeit als internationale Sprache der
Wissenschaften und des Klerus und damit der gebildeten Bevölkerung.
Iro-schottische Mönche, die auf ihren Missionsreisen das
Christentum in Europa verbreiteten, waren wohl die ersten, die in Klosterschulen
Latein lehrten. Latein galt über das gesamte Mittelalter bis
in die frühe Neuzeit als internationale Sprache der
Wissenschaften und des Klerus und damit der gebildeten Bevölkerung.
Noch im 19. Jh.
hob sich das (humanistische) Gymnasium als Schulform durch den Unterricht in
Latein (oft zusätzlich auch in Griechisch) von anderen Schulformen ab. Selbst
heute noch wird für etliche Studienfächer das Latinum als Nachweis entsprechender
Lateinkenntnisse verlangt (z. B. bei einem Teil der Geisteswissenschaften). Seit
den 1930er Jahren verliert Latein an Bedeutung und spätestens in der zweiten
Hälfte des 20. Jh. wurde es durch die neue Weltsprache Englisch vom
Spitzenplatz der Sprachen verdrängt, doch für eine „tote Sprache“ (so eine
langjährige Behauptung) führt es immer noch ein bemerkenswertes Eigenleben mit
teilweise sogar wieder wachsenden Schülerzahlen.
Zur Verfügung gestellt von Margret Biemer, Arenberg.
Fibel zum
Lesenlernen in Sütterlin-Schrift 1915/16
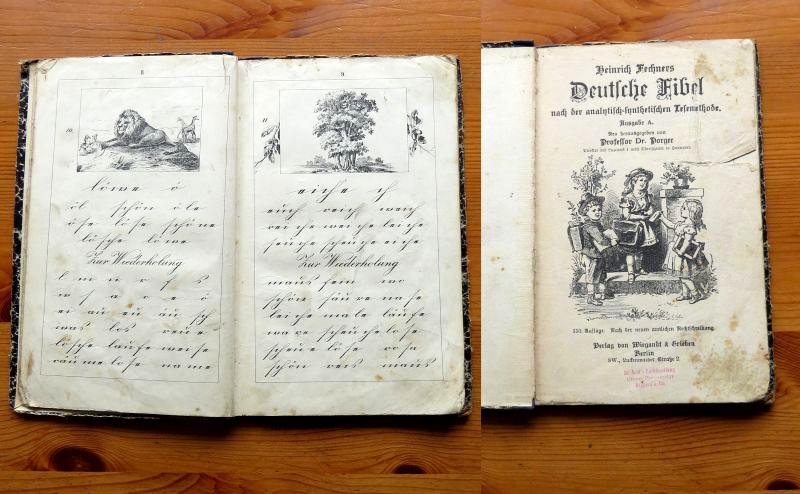 Diese
Fibel von 1915/16 ist für uns gar nicht so leicht zu lesen, obwohl
(oder weil?) sie ihre Inhalte in schönster deutscher Schreibschrift
(Sütterlin) wiedergibt. Die abgebildete Deutsche Fibel lehrte das
Lesen bereits nach der analytisch-synthetischen Methode. Das bedeutet,
sie begann
mit ganzen Wörtern oder Sätzen, welche aber auch in ihre einzelnen Elemente
(Silben und Buchstaben)
zerlegt wurden. So wurden Synthese (Buchstabe für Buchstabe) und Analyse (ganze
Worte) gleichzeitig eingeführt.
Diese
Fibel von 1915/16 ist für uns gar nicht so leicht zu lesen, obwohl
(oder weil?) sie ihre Inhalte in schönster deutscher Schreibschrift
(Sütterlin) wiedergibt. Die abgebildete Deutsche Fibel lehrte das
Lesen bereits nach der analytisch-synthetischen Methode. Das bedeutet,
sie begann
mit ganzen Wörtern oder Sätzen, welche aber auch in ihre einzelnen Elemente
(Silben und Buchstaben)
zerlegt wurden. So wurden Synthese (Buchstabe für Buchstabe) und Analyse (ganze
Worte) gleichzeitig eingeführt.
Zur Verfügung gestellt
von Margret Biemer, Arenberg.
Sütterlin-Schrift / Deutsche Schreibschrift
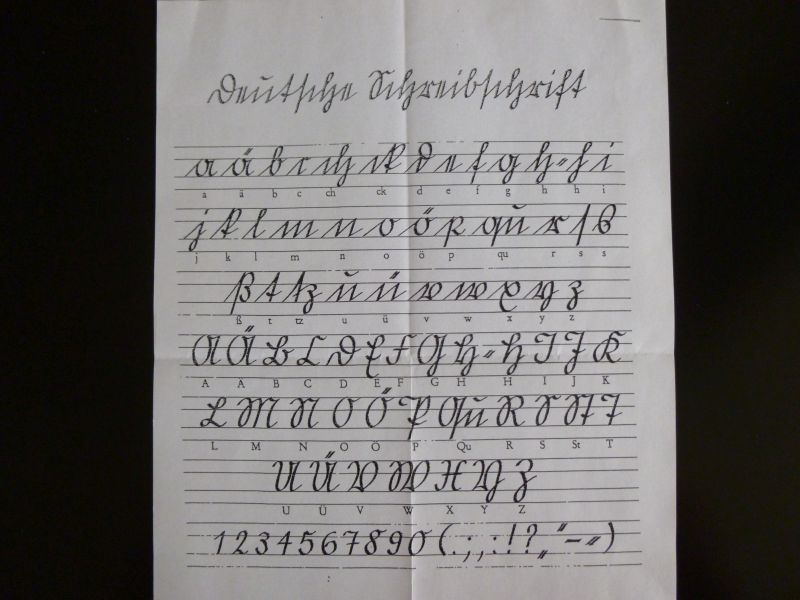 Schreibschrift, die nach dem Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin
(1865-1917) benannt ist. Sie wurde von 1915 bis
etwa 1940 und dann noch einmal von etwa 1952 bis 1954 in deutschen Schulen
unterrichtet, später auch als zusätzliche Schrift neben der lateinischen Ausgangsschrift
im Schönschreibunterricht eingesetzt. Sütterlin wird im Volksmund auch die "deutsche Schreibschrift"
genannt. Sie ist eine Standardform der vorher üblichen,
sehr verschiedenen Kanzleischriften. Wer heute alte Urkunden lesen muss oder
möchte, kommt häufig um das Erlernen dieser Schrift nicht herum.
Schreibschrift, die nach dem Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin
(1865-1917) benannt ist. Sie wurde von 1915 bis
etwa 1940 und dann noch einmal von etwa 1952 bis 1954 in deutschen Schulen
unterrichtet, später auch als zusätzliche Schrift neben der lateinischen Ausgangsschrift
im Schönschreibunterricht eingesetzt. Sütterlin wird im Volksmund auch die "deutsche Schreibschrift"
genannt. Sie ist eine Standardform der vorher üblichen,
sehr verschiedenen Kanzleischriften. Wer heute alte Urkunden lesen muss oder
möchte, kommt häufig um das Erlernen dieser Schrift nicht herum.
Lesebücher für Volksschulen aus den 1950er/60er
Jahren
Nach dem 2. Weltkrieg änderte sich das Schriftbild und aus der deutschen
Schrift (Sütterlin) wurde die lateinische Schrift. Die Inhalte der Bücher waren
oft auf die Region bezogen, so dass sie in der Sache oft auch schon vertraut
waren (siehe auch unten).
Das Aussehen war jetzt deutlich modernisiert. In den Fibeln herrschte immer
noch die analytisch-synthetische Methode (s. o.) vor.
Inhalte der
Schul-Lesebücher in den 1950er/60er Jahren
Einige Beispiele aus dem Inhalt der o. a. Lesebücher: In der Immendorfer
Volksschule war es z. B. Brauch, dass für den Samstagsunterricht drei Gedichte
nach Wahl gelernt werden sollten. Da kamen Vierzeiler wie das Gedicht von der
Eule gerade recht. Lange Gedichte, wie z. B. "Das Lied von der
Glocke" fanden dagegen - Schiller sei's geklagt - oft nur als Strafarbeit
Beachtung. Sagen des Rheinlandes, Märchen der Gebrüder Grimm und die Legenden
bekannter Helden und Heiliger fanden sich ebenso, wie die traditionellen
Rollenbilder der Gesellschaft von tüchtigen Bauern und Handwerkern. Frauen
spielten dagegen nur die traditionell brave Rolle der Mutter und Hausfrau;
Ausnahmen gab es allenfalls bei heiligen oder adeligen Damen.
Schulranzen (1959)
 Zur Einschulung im Jahre 1959 wurde
ich stolze Besitzerin dieses Leder-Schulranzens, der 33 x 27 x 9
cm klein war, gerade groß genug, um eine DIN A4 große Schiefertafel,
einen Griffelkasten, ein Schwammdöschen und einige Schulbücher und DIN
A5 Hefte darin zu verstauen.
Zur Einschulung im Jahre 1959 wurde
ich stolze Besitzerin dieses Leder-Schulranzens, der 33 x 27 x 9
cm klein war, gerade groß genug, um eine DIN A4 große Schiefertafel,
einen Griffelkasten, ein Schwammdöschen und einige Schulbücher und DIN
A5 Hefte darin zu verstauen.
Zur Verfügung gestellt von Elfriede Böhm, Immendorf.
Stickmustertuch
von 1884
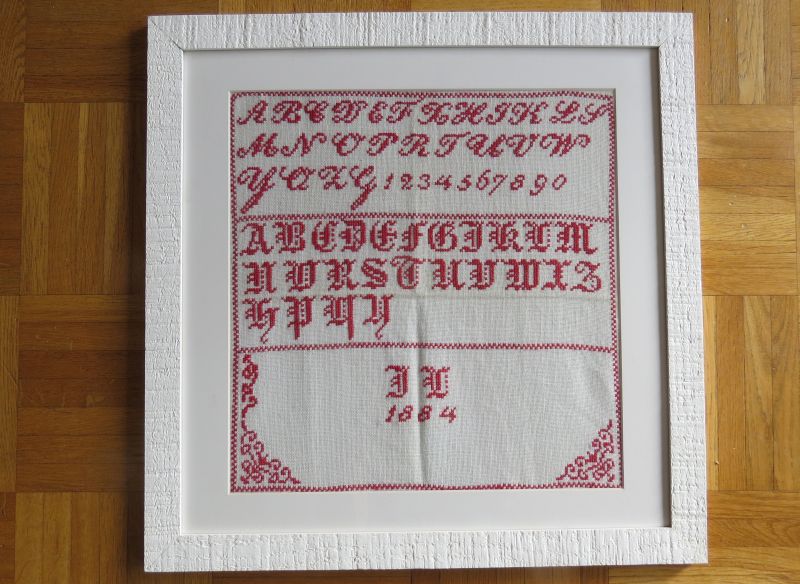 Die
hohe Kunst des Stickens lernten Mädchen bereits in frühen Jahren,
sollten sie doch möglichst viele Handarbeitstechniken
aus dem FF beherrschen. Das Sticken galt dabei eher als
dekorative Kunst, mit der selbst hochgestellte Damen ihre
freie Zeit gestalteten. Nähen, Flicken und Stricken waren natürlich
für einfache Menschen noch weit wichtiger, da diese Techniken die grundlegenden
Bedürfnisse eines Haushalts eher erfüllen konnten. Das abgebil-
dete
Stickmustertuch vermittelt einen Ein- blick in die beachtli- che Kunstfertigkeit
der Mädchen unserer Groß- und Urgroßmüttergeneration.
Zur Verfügung gestellt
von Margret Biemer, Arenberg.
Die
hohe Kunst des Stickens lernten Mädchen bereits in frühen Jahren,
sollten sie doch möglichst viele Handarbeitstechniken
aus dem FF beherrschen. Das Sticken galt dabei eher als
dekorative Kunst, mit der selbst hochgestellte Damen ihre
freie Zeit gestalteten. Nähen, Flicken und Stricken waren natürlich
für einfache Menschen noch weit wichtiger, da diese Techniken die grundlegenden
Bedürfnisse eines Haushalts eher erfüllen konnten. Das abgebil-
dete
Stickmustertuch vermittelt einen Ein- blick in die beachtli- che Kunstfertigkeit
der Mädchen unserer Groß- und Urgroßmüttergeneration.
Zur Verfügung gestellt
von Margret Biemer, Arenberg.
Handarbeitskorb
 Zum Unterricht ausschließlich für Mädchen gehörte bis in die
1960er Jahre das Fach Handarbeit. Die Utensilien dafür (Häkel-, Stick- oder
Strickzeug) wurden im Handarbeitskörbchen mit in die Schule genommen.
Zum Unterricht ausschließlich für Mädchen gehörte bis in die
1960er Jahre das Fach Handarbeit. Die Utensilien dafür (Häkel-, Stick- oder
Strickzeug) wurden im Handarbeitskörbchen mit in die Schule genommen.
Zur Verfügung gestellt von Elfriede Böhm, Immendorf.